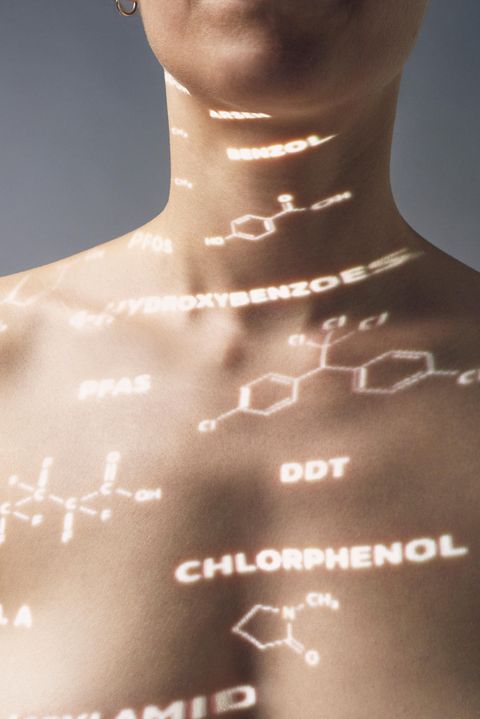Unter den mehreren Hundert Arten von Buntbarschen, die am Rand des Tanganjikasees in Zentralafrika leben, gibt es manche wundersame Gestalt. Etwa die Wulstlippenbuntbarsche, deren Lippen zu einer Art Schmollmund vergrößert sind. Der schützt vermutlich vor Verletzungen, wenn die Fische ihre Beute aus Steinritzen ziehen.
Blau gesprenkelt sind die Algenraspler, die mit ihren Zähnchen Pflanzen von den Felsen meißeln. Leuchtend gelbe Schneckenknacker pulen mit spitzen Fresswerkzeugen die Weichtiere aus ihren Gehäusen, und schlanke, türkis schimmernde Schuppenfresser knabbern an den Flanken von Artgenossen.
Wulstlippenbuntbarsche, Algenraspler und Schneckenknacker gibt es auch im 300 Kilometer entfernten Malawisee. Und auch im Viktoriasee, weitere 300 Kilometer nordöstlich. Möglicherweise, so vermuteten manche Forscher jahrzehntelang, sind einige Exemplare jeder Art irgendwann über Flüsse von einem See in die beiden anderen geschwommen. Die Spezies hätten sich dort zwar weiterentwickelt, die jeweilige Anpassung – etwa eine spitze Schnauze – sei aber nur einmal entstanden.
Konvergenz: Gleiche Bedingungen bringen gleiche Formen hervor
Doch als Wissenschaftler um den Konstanzer Evolutionsbiologen Axel Meyer vor einigen Jahren das Erbgut der Fische analysierten, staunten sie: Die verschiedenen Buntbarsche in den drei Seen ähneln sich zwar – aber sie stammen nicht direkt voneinander ab. Vielmehr verdanken die Fische ihr übereinstimmendes Aussehen einem grundlegenden Prinzip der Evolution: der Konvergenz. So nennen es Biologen, wenn Arten verblüffend ähnliche Merkmale entwickeln, obwohl sie nicht oder nur weit entfernt miteinander verwandt sind.
Die dicken Lippen der Buntbarsche zum Beispiel hat die Evolution in allen drei Seen jeweils getrennt voneinander hervorgebracht – weil ihre Form einen Überlebensvorteil bietet: Sie sind offenbar eine gute Anpassung für jene Fische, die ihre Beute zwischen spitzen Steinen heraussaugen und ihre Schnauze dabei vor Verletzungen schützen.
Über alle Kontinente verteilt leben Tiere und Pflanzen, die sich auf erstaunliche Weise ähneln, weil sie sich konvergent entwickelt haben. Die Übereinstimmungen entstehen, wenn sich unterschiedliche Lebewesen an gleiche Umweltbedingungen anpassen müssen – an heißes Klima, an schwer zugängliche Beute oder an besondere Lebensräume – und die Evolution dann die gleichen Lösungen findet.
Maulwurf und Beutelmull benutzen die gleiche Schaufeltechnik
Der europäische Maulwurf etwa kommt in seinem Lebensraum gut zurecht, denn seine Vorderbeine sind zu mächtigen Grabschaufeln umgestaltet. So kann er sich durch das Erdreich wühlen. Die gleiche Fähigkeit benötigt der ebenfalls unterirdisch lebende Beutelmull in Australien. Obwohl Beutelmull und Maulwurf von unterschiedlichen Vorfahren abstammen und ihre Lebensräume 13 000 Kilometer voneinander entfernt sind, sehen sich die Grabschaufeln der beiden Arten recht ähnlich – weil ihre Form darauf optimiert ist, Boden beiseitezuschaffen.
Der Kolibrischwärmer, ein Schmetterling, steht scheinbar still in der Luft, wenn er mit seinem langen Rüssel Nektar aus einer Blüte saugt. Mehr als 70 Mal pro Sekunde schlägt er dabei mit den Flügeln. Außerdem kann er rückwärts fliegen. Die gleiche Kunst beherrscht der Kolibri – ein Vogel, der mit bis zu 80 Flügelschlägen je Sekunde in der Luft stillstehen kann und mit seiner extrem langen Zunge Nektar aus tiefen Blüten saugt. Es ist eine sehr ähnliche Flugtechnik – doch das eine Mal mit einem Insektenflügel aus Chitin verwirklicht, das andere Mal mit dem gefiederten Arm des Vogels.
Auch die harten Lebensbedingungen von Wüstenpflanzen haben zu ähnlichen Entwicklungen geführt: Bestimmte Kakteen in Mexiko etwa haben Sprossachsen hervorgebracht, deren Zellen Flüssigkeit speichern und die ihre Oberfläche in Dürrezeiten vermindern können, um so weniger Wasser verdunsten zu lassen. Zudem lagern sie rote Pigmente in ihrem Stamm ein, die sie wie tot erscheinen lassen, und tragen kurze Dornen, die vor Fressfeinden schützen.
In afrikanischen Wüsten wachsen scheinbare Verwandte – stachelige Pflanzen, die den mittelamerikanischen Kakteen täuschend ähnlich sehen. Doch es sind Wolfsmilchgewächse, die entwicklungsgeschichtlich nur wenig mit ihnen gemein haben.
zurück zur Hauptseite
Auch wenn es darum geht, toxische Substanzen zu injizieren, haben Lebewesen unterschiedlichster Herkunft – Quallen, Skorpione, Insekten, Schnecken, Fische – alle die gleiche Waffe entwickelt: den Giftstachel. Und das Auge ist quer durchs Tierreich sogar mehr als 50 Mal entstanden. Eine besonders leistungsfähige Form des Sehorgans ist das Linsenauge. Die Linse fängt das Licht ein, bündelt es und liefert ein Abbild der Außenwelt. Sie erlaubt es, nah wie fern scharf zu stellen und Bewegungen zu verfolgen.
Obwohl dieses Auge ungemein komplex ist, haben es gleich mehrere Tiergruppen hervorgebracht, darunter Tintenfische, Wirbeltiere, einige Quallen und sogar Ringelwürmer. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Komponenten. So wächst die Netzhaut, also der lichtempfindliche Teil des Auges, beim Menschen aus Zellen des Nervensystems. Das geschieht, indem sich beim menschlichen Embryo ein Teil des Gehirns ausstülpt und zum Augenbecher wird. Bei den Tintenfischen dagegen entsteht die lichtempfindliche Schicht aus der äußeren Zellschicht, die sich becherförmig zur Augengrube einsenkt.
Organe, die durch konvergente Entwicklungen entstehen, können sich also – wie die Augen – äußerlich stark ähneln, sich jedoch im Detail und von der Entwicklung her sehr unterscheiden.
Homologie: Zwei Tiere sind verwandt, sehen aber verschieden aus
Doch es gibt auch den umgekehrten Fall: Körperteile sehen völlig ungleich aus und haben unterschiedliche Funktionen – sind aber entwicklungs-geschichtlich verwandt. Die glatte Vorderflosse eines Delfins beispielsweise ist zum Schwimmen optimal geeignet, der ledrige, ausladende Flügel einer Fledermaus zum Fliegen und der menschliche Arm mit seiner Greifhand zum Hantieren. Ihre Formen und Funktionen sind also sehr unterschiedlich – dennoch findet sich in ihrem Inneren stets ein großer Knochen, der mit zwei weiteren sowie mit mehreren kleinen Knöchelchen verbunden ist, an die sich Finger anschließen.
Hinter dieser Entwicklung steckt ein weiteres elementares Prinzip der Evolution: die Homologie, das Gegenstück zur Konvergenz. Homologie bedeutet, dass Körperteile, obwohl sie sich in Form und Funktion stark unterscheiden, den gleichen Grundbauplan aufweisen, weil die betreffenden Arten vom selben Vorfahr abstammen.
Die Flossen einiger urzeitlicher Fische etwa haben sich zu vier Gliedmaßen gewandelt, als sich einige von ihnen an ein Leben außerhalb des Wassers anpassten. Von ihnen stammen alle Landwirbeltiere ab – und die erbten den gemeinsamen Grundbauplan. Daraus hat sich dann im Laufe von Jahrmillionen eine erstaunliche Vielfalt an Gliedmaßen entwickelt. Die Armknochen bei der Fledermaus wurden kürzer, ihre Finger verlängerten sich stark, sodass dazwischen Platz für die Flughäute entstand. Beim Frosch hingegen verlängerten sich die Beinknochen, verschmolzen zum Teil miteinander und ermöglichten ihm, sich in weiten Sprüngen fortzubewegen.
Aus Hautschuppen entwickelten sich Zähne
Homologien beschränken sich aber nicht nur auf Extremitäten. So ist ein menschlicher Zahn homolog zu den Schuppen auf der Haut von Haien: Beide bestehen aus Zahnschmelz, und in ihrem Inneren findet sich eine Markhöhle. Aus den Schuppen eines gemeinsamen Vorfahren haben sich die Zähne jener Fische entwickelt, die später das Land eroberten und unter anderem zu den Urahnen des Menschen wurden.
Fischembryonen tragen auf jeder Seite des Kopfes vier Verdickungen und Furchen, die Kiemenbögen. Wächst der Fisch heran, öffnen sich die Vertiefungen, sodass Wasser hindurchströmen kann – der Fisch hat Lücken zwischen den Kiemen gebildet.
Auch der menschliche Embryo verfügt über solche Furchen, bei ihm bleiben sie jedoch geschlossen. Stattdessen bilden sich aus den ersten beiden Verdickungen die Kiefer, Gehörknöchelchen, Muskeln und Nerven.
Die Kieferknochen sind also homolog zu den Kiemenbögen.
So verhält es sich auch mit der menschlichen Lunge. Sie ist homolog zur Schwimmblase, die vielen Fischen den nötigen Auftrieb verleiht. Beide Organe entstanden aus einer Ausstülpung des Vorderdarms. Bei denjenigen Tieren, die irgendwann das Wasser verließen, entwickelte sich daraus eine komplex aufgebaute Lunge. Bei anderen Fischen dagegen wandelte sich die Ausstülpung später zur Schwimmblase.
Wer einen Fisch betrachtet, sieht also immer auch ein Stück von sich selbst. Und umgekehrt: In fast jedem seiner Körperteile kann der Mensch Erinnerungen an die Urzeit erkennen. Er trägt die Geschichte des Lebendigen in sich.